 |
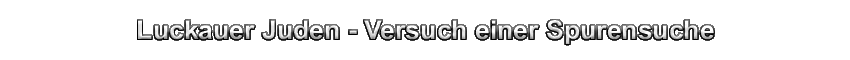
- Vorwort
- Teil I
- Teil II
- Teil III
- Teil IV
- Teil XIII
- Personenschicksale
- Namensverzeichnis A-L
- Namensverzeichnis M-Z
- Namensverzeichnis Grätz
- Namensverzeichnis Birnbaum
- Friedhöfe:
- Märkisch Buchholz
- Friedland
- Forst-Berge
- Meinsdorf
- Beeskow
- Tirschtiegel
Vorwort
|
80 km südlich von Berlin liegt das beschauliche Städtchen
Luckau. Eine ältere
Dame, welche ihre Kindheit und Jugend in der Gegend verbracht hatte,
erzählte
mir vor längerer Zeit, welches Bild sich ihrem Vater am 11. 11.
1938 in Luckau bot. Die Textilgeschäfte
der jüdischen Inhaber Hohenstein und Simon waren zerstört worden.
Die Waren und ihre persönlichen Sachen lagen auf der Straße.
Also hatte sich auch hier der Zorn gegen das »jüdische Verbrechertum« entladen. Wer waren diese Menschen und was ist ihnen widerfahren? 61 Jahre nach Kriegsende begann die Spurensuche. Mein erster Weg führte in das Niederlausitz-Museum Luckau. Hier findet sich eine Vitrine mit Ausstellungsstücken, die über das Schicksal des jüdischen Arbeiters David Tasselkraut Auskunft geben. Er war in der Ortsgruppe der SPD in Luckau organisiert und auch Mitglied der Reichsbanner-Organisation gewesen. Ende der achtziger Jahre erschienen im Luckauer Heimatkalender Beiträge über das Schicksal jüdischer Bürger. Hier stieß ich wieder auf die Namen Simon, Hohenstein, Tasselkraut sowie Neumann und Weinberg. Recherchen in den Archiven und in den Gedenkbüchern für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ergaben, dass weit mehr Opfer zu beklagen sind. Das liegt auch daran, das sich mein Fokus nicht allein auf jüdische Bürger richtete, die in der Vorkriegszeit in Luckau lebten, sondern in und um Luckau geboren wurden. Nicht einbezogen wurden Juden, die sich zur Zeit der Volkszählung im Mai 1939 im Zuchthaus Luckau befanden und dort automatisch ihre Meldeadresse hatten. Viel Aufschluss erhoffte ich mir von der 2000 erschienenen Autobiografie von Johanna Tuliszka. 1937 kam sie als Vierzehnjährige mit ihrer Familie nach Luckau. Trotz der fotografischen und minutiösen Erinnerungsgabe sind die Vorgänge im November 1938 jedoch ausgeblendet. Zwischen dem Führerinnen-Lager der BDM Mädel im Sommer und dem Schlittenfahren in den Weihnachtsferien gab es keine nennenswerten Ereignisse. Auch die große „Protestkundgebung” am 10. 11. 38 und die darauf folgende Zerstörung der jüdischen Geschäfte nahm sie nicht wahr. Wahrscheinlich symptomatisch für diese Generation. Der stillschweigenden Wahrnehmung folgt auch später keine Aufarbeitung. Victor Klemperer formulierte es im Dezember 1939 in seinem Tagebuch: „Die Pogrome im November 38 haben, glaube ich, weniger Eindruck auf das Volk gemacht als der Abstrich der Tafel Schokolade zu Weihnachten”. Bisher ließ sich nicht erkennen, dass jüdische Familien über Generationen in Luckau lebten. Da die jüdische Bevölkerung immer schon unter Edikten, Reglementierungen und Vertreibungen zu leiden hatte, waren sie gezwungener Maßen Ortswechseln unterworfen. Auch ihr verordnetes eingeschränktes Berufsfeld - sie waren hauptsächlich als Kaufleute tätig - zwang die Familien häufig umzuziehen, um ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Luckau hatte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts durchschnittlich 5000 Einwohner, dadurch ergaben sich natürlich begrenzte Marktchancen. Der anfängliche Gedanke, sich auf die Geschichte der Luckauer Juden des 20. Jahrhunderts zu beschränken, wurde im Laufe der Recherchen hinfällig. Mit dem Wissen um jüdische Vergangenheit in Luckau kam zwangsläufig auch die Neugierde, frühere Spuren zu finden. Die Dokumentation gliedert sich nun in 5 Bereiche. Obwohl sich die Grenzen der Mark Brandenburg und der Lausitzer Mark durch die Machtverhältnisse in den Jahrhunderten immer wieder veränderten und zeitweise auch ineinander übergingen, habe ich die Länder thematisch getrennt. Teil 1 behandelt die Geschichte der Juden in der Mark Brandenburg und dem späteren Preußen vom 12.-19. Jahrhundert. Hier habe ich mich auf Berlin, die Mittelmark und die Altmark konzentriert. Teil 2 behandelt die Geschichte der Juden in der Lausitzer Mark und der späteren Niederlausitz vom 13.-19. Jahrhundert. Die beiden ersten Teile können natürlich nur einen Abriss der Geschichte wiedergeben, da der Umfang diesen Rahmen übersteigen würde. In Teil 3 geht es ausschließlich um die jüdische Bevölkerungsentwicklung in Luckau und den dazu gehörenden Gemeinden im 19. Jahrhundert. Teil 4 beinhaltet statistische Angaben und die politische Entwicklung bis zum Beginn der Deportationen. Im 5. Teil sind alle ermittelten Opfer der NS-Zeit erfasst, die im Landkreis Luckau geboren wurden oder bis zur Vertreibung und Deportation dort lebten. Diesbezüglich ist es nicht auszuschliessen, dass Personen nicht ermittelt werden konnten. Wenn im Landkreis Luckau lebende Juden hier nicht geboren wurden und infolge der Pogrome die Gegend verließen, lässt sich später kein Zusammenhang herstellen. Meldeunterlagen sind nicht mehr vorhanden. Wenn Sie Hinweise oder Informationen geben können, würde ich mich freuen, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen würden. Die am rechten Seitenrand eingefügten Fotos können einzeln aufgerufen werden oder fortlaufend mit next oder prev betrachtet werden. Dafür müssen Sie in Ihrem Browser das Anzeigen von aktiven Inhalten (Skripts und ActiveX-Steuerelemente) zulassen. Die Angaben in den Klammern hinter den Namen der Herrscher beziehen sich auf die Amtszeit. Begrifflichkeiten der Sprache des Dritten Reiches sind in » « gesetzt. Die vorliegende Arbeit wäre ohne die Informationen kompetenter Fachleute nicht möglich gewesen. Mein Dank gilt folgenden Personen: Den Mitarbeiterinnen der Standesämter Heideblick, Luckau, Lübben und Teupitz Frau Monika Liebscher von der Gedenkstätte Sachsenhausen Frau Dr. Monika Nakath und Frau Katrin Grün vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam und Frau Kathrin Schröder Außenstelle Lübben Herr Thomas Mietk vom Kreisarchiv in Lübben Frau Völschow und Frau Lahn vom Bundesarchiv in Berlin Frau Dr. Karoline Tschuggnall Lektorin Herr Christian Carlsen, Historiker Berlin Frau Equitz vom Niederlausitz-Museums in Luckau und Frau Tuček, Leiterin des Niederlausitz-Museum in Luckau, für ihre Unterstützung, insbesondere die langen Gespräche und ihren lektorischen Beistand. Mein besonderer Dank gilt den Nachfahren der Opfer: Julien Hamburger, New York René Hohenstein, Cochabamba, Bolivien Karl-Heinz Tasselkraut, Berlin Charles Leigh, Broadstairs England David Klaus Oppenheim, Los Angeles, Kalifornien Gideon Argon, Kfar Saba, Israel William Wermuth, BRD Birger Nordmark (Forscher), Schweden .... und dem unvergleichbaren Online-Archiv der Polnischen Staatsarchive. Nicht unerwähnt möchte ich Behörden und Institutionen lassen, welche sich nicht kooperativ zeigten. Das Standesamt und der Bürgermeister der Stadt Bad Muskau vertreten die Auffassung, dass diese Arbeit privaten und nicht heimatkundlichen Charakter hätte. Die geforderten Gebühren sind, da das Projekt keine finanzielle Unterstützung erfährt, indiskutabel. Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide reagiert auf Anfragen gar nicht. |
 |